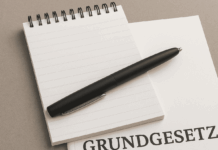Kritik und Kontrolle durch Medien – Ergänzung der klassischen Gewaltenteilung

Begriff
Man kann die modernen Massenmedien als → System begreifen, das durch Journalismus eine Selbstbeobachtung der Gesellschaft ermöglicht. Dazu haben sie im Laufe ihrer Geschichte bestimmte Strukturen herausgebildet, die diese Selbstbeobachtung institutionell und professionell organisieren. Ihre Akteur:innen entwickelten dann im Laufe ihrer Berufsgeschichte ein Rollenselbstverständnis, das neben der Information der Bevölkerung über relevante Themen auch auf Kritik und Kontrolle der gesellschaftlichen Zustände und der Kräfte gerichtet ist, die im Staat Macht ausüben. Insofern stellen sie selbst eine Macht dar, die als ‚Vierte Gewalt‘ bezeichnet wird und einen öffentlichen Auftrag erfüllt – ohne dass damit der Anspruch erhoben werden kann, dass → Massenmedien denselben Verfassungsrang besitzen wie Legislative, Exekutive und Judikative; vielmehr handelt es sich eher um eine ‚virtuelle Säule‘ in der modernen Gesellschaft. Durch Massenmedien, die unabhängig von staatlichen Restriktionen die Funktion einer solchen Vierten Gewalt ausüben können, unterscheiden sich demokratische von autoritären Gesellschaften. (Vgl. z. B. Schultz 2021: 9 ff.; Weischenberg et al. 2006: 12, 21 ff.)
Von den auf Charles de Montesquieu zurückgehenden ‚klassischen Gewalten‘ unterscheiden sich die Massenmedien und ihr Journalismus nicht nur dadurch, dass ihnen keine institutionalisierten Sanktionsinstrumente zur Verfügung stehen, sondern auch durch die prinzipiell universelle Vielfalt ihrer Objekte: „Regierung, Opposition und Verwaltung, Gesetzgebung und Rechtsprechung stehen als Themen der Kritik zur Verfügung, wie alle Bereiche und Institutionen des gesellschaftlichen Lebens – darunter auch die Massenmedien selbst.“ (Bergsdorf 1980: 87) Zahlreiche Publikationen verweisen schon in ihrem Titel auf das Thema ‚Vierte Gewalt‘. Dies bedeutet aber nicht, dass mit diesem Begriff stets dasselbe gemeint ist oder auch nur, dass sich die damit verbundenen Intentionen decken. Oft geht es darin auch nicht primär darum, den Terminus erkenntnisfördernd einzusetzen, sondern z. B. darum, eine Gruppe von (prominenten) Medienakteur:innen abzubilden, die ihre Berufsrolle als → ‚investigativ‘ interpretieren. Oder einen Anspruch zu beschreiben, an dem die Medienrealität (zwangsläufig?) scheitern muss – oder auch nur, um den Begriff als Synonym für ‚die Presse‘ zu verwenden. (Vgl. z. B. Schröter/Gerlach 2008; Precht/Welzer 2023; Hamann 2007).
Geschichte
Die Bezeichnung der Presse als ‚Vierte Gewalt‘ ist Mitte des 19. Jahrhunderts wohl zuerst in angelsächsischen Ländern (‚fourth estate‘) gebräuchlich geworden, nachdem im Gefolge der Aufklärung politische, religiöse und ökonomische Freiheiten erkämpft worden waren – verbunden dann auch mit Forderungen nach mehr Liberalität für journalistische Berichterstattung und Kritik. Zwangsläufig ergab sich daraus auch ein Funktionsverständnis, das auf eine Kontrolle von Regierungen hinauslief. Dies war schon 1644 in John Miltons berühmter Rede Areopagitica über die Freiheit der Presse („free marketplace of ideas“) angelegt und fand dann seinen Niederschlag im First Amendment der amerikanischen Verfassung. In Deutschland gab es seit Ende des 18. Jahrhunderts Bestrebungen, die Gedanken der Aufklärung beim Ringen um bürgerliche Freiheiten und gegen den autoritären Staat umzusetzen. Verbunden damit war die Forderung nach → Pressefreiheit, die bei der Märzrevolution von 1848 zur Lockerung der Zensurbestimmungen und dann 1874 zum Reichspressegesetz führte.
Doch auch in den Jahrzehnten danach war der deutsche Journalismus weiter an politische, ideologische und ökonomische Interessen gebunden und nie wirklich frei – ehe er dann nach 1933 von den Nationalsozialisten ‚gleichgeschaltet‘ und völlig den Parteiinteressen unterworfen wurde. Nach Kriegsende dauerte es mehr als ein Jahrzehnt, ehe sich auf breiter Linie ein Verständnis herausbildete, das die Kritik- und Kontrollfunktion von Massenmedien deutlicher sichtbar werden ließ. Auch insofern hatte es in den Jahren nach 1945 zunächst keine ‚Stunde Null‘ bei der deutschen Presse gegeben. (Vgl. Kunczik 1988: 12 ff., 60; Donsbach 2008: 147 ff., Blum 2008: 235 ff.)
Eine wichtige Rolle spielte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel und schließlich das auf ihn gemünzte Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 5. August 1966, auf dessen Grundlage die Pressefreiheit gestärkt wurde und auch das Selbstverständnis als ‚Vierte Gewalt‘ im deutschen Journalismus an Bedeutung gewann. Die funktionale Deutung des Urteils führte zu dem Schluss, dass die Garantie freier Medien zur Verwirklichung des demokratischen und sozialen Rechtsstaats unabdingbar ist. Ihnen wurde dabei die Aufgabe zugewiesen, für eine umfassende Meinungsbildung der Bevölkerung zu sorgen, damit die Bürgerinnen und Bürger vernünftige politische Entscheidungen treffen können. Explizit ist hier von einer „öffentlichen Aufgabe“ die Rede, die, wie es ausdrücklich heißt, „von der organisierten staatlichen Gewalt“ nicht erfüllt werden könne. Die „Freie Presse“ wird in dem Urteil explizit als „Institut“ bezeichnet (zit. n. Weischenberg 2004: 130 ff.).
Schon Jahre zuvor hatte der Presserechtler Martin Löffler die Funktion der Presse als Vierte Gewalt auch mit den real existierenden Verhältnissen im politischen System auf eine Weise begründet, die bis in die Gegenwart hinein Gültigkeit besitzt. Sie sei „die wesentliche und oft einzige Institution“, die zu neuen Impulsen und besonders zur Kontrolle der Staatsgewalten in der Lage sei: „Vor allem die Parlamentsmehrheit ist mit der Regierung über das Parteiensystem so vielfältig verflochten, daß sie daher weder bereit noch fähig ist, die Kontrolle der Exekutive wirkungsvoll zu ermöglichen.“ Das habe dazu geführt, „daß der von Montesquieu entwickelte Idealtyp der Gewaltenteilung und Gewaltenhemmung nicht mehr funktioniert“ (Löffler/Ricker 1978: 19).
Aktualität
Zweifel an der Funktionsfähigkeit der Demokratie und ihrer politischen Kommunikation richten sich inzwischen auch gegen die Massenmedien selbst, die sich seit Jahren scharfer Kritik ausgesetzt sehen (vgl. Prinzing/Blum 2021: insbes. 832-858, 859-879). Dies hat zu einer Legitimationskrise des Journalismus geführt, wobei die Auseinandersetzungen über seine Qualität in den letzten Jahren mit zunehmender Schärfe geführt worden sind. Sie werden zwar auch in eher distanzierter Form als „aktuelle Herausforderungen“ beschrieben (v. Garmissen 5 f.). Dominierend in der öffentlichen Wahrnehmung sind jedoch bei den Debatten im Internet und den ‚Pegida‘-Demonstrationen auf der Straße eine Zeitlang vor allem extreme Vokabeln wie → ‚Lügenpresse‘ oder ‚Systempresse‘ gewesen; auch in Darstellungen, die wissenschaftlichen Anspruch erheben, wurde der Ton zunehmend rauer. (Vgl. z. B. Weischenberg 2018: insbes. 267-283; Ataman 2018; Weischenberg 2021)
Selbst überzogene Kritik konnte mit dem Argument punkten, dass die Kritik- und Kontrollfunktion des Journalismus allzu offensichtlich zugunsten eines ‚Mainstreaming‘ in den Hintergrund getreten sei, der sich vor allem in Form einer Anpassung an die Linie von Leitmedien nachweisen lasse. Hier wurden zunächst die Flüchtlingskrise und dann die Ukraine-und Corona-Berichterstattung immer wieder als besonders markante Beispiele angeführt. Große Beachtung fand die auf dieser Linie argumentierende → Medienkritik des Publizisten Richard David Precht und des Soziologen Harald Welzer – nicht zuletzt auch deshalb, weil beide durch ihre häufigen TV-Auftritte prominent sind. Deshalb konnten sie ihr Buch Die vierte Gewalt in diversen Talkshows präsentieren, mussten dabei aber auch in Kauf nehmen, dass sich die dort als Gesprächspartner versammelten → Journalist:innen für geharnischte ‚Anti-Kritiken‘ präpariert hatten. Das pauschale Urteil der Autoren, dass die Medien zunehmend Meinungsmache betrieben, einseitig berichteten, moralisierten, simplifizierten und auch diffamierten und so die ‚Empörungs-Gesellschaft‘ bedienten, wollten sie nicht auf ihrer Branche sitzen lassen. Auch ein versöhnlich klingender Satz gleich am Anfang des Buches konnte das Medienecho nicht mildern: „Wir müssen verstehen, wie unsere Demokratie nicht durch Willkür und Macht ‚von oben‘, sondern aus der Sphäre der Öffentlichkeit selbst unterspült wird – erst dann kann die Vierte Gewalt ihrer Rolle wieder gerecht werden“ (Precht/Welzer 2022: 2).
Forschungsstand
→ Kommunikations-, → Politik– und → Rechtswissenschaft beschäftigen sich mit dem Thema ‚Vierte Gewalt‘ im Zusammenhang mit den Stichworten ‚Kommunikationsfreiheit‘ und ‚Kommunikationspolitik‘, wobei historische und philosophische Aspekte eine zentrale Rolle spielen (vgl. z. B. Tonnemacher 2005). Dabei wird auch der Begriff selbst problematisiert und sogar als „missverständlich und anmaßend“ bezeichnet; eher sei schon die Bezeichnung „Vierte Macht“ angemessen (Langenbucher/Wippersberg 2005). Als zumindest ‚umstritten‘ wird von anderen Autoren bezeichnet, dass den Medien eine eigene Kontrollfunktion, die im Zentrum der Rede von der Vierten Gewalt steht, überhaupt zugestanden werden soll. Der Begriff tauge eher als „Metapher“, meint z. B. Roland Burkart (2021: 132 f.) in seiner grundlegenden Übersicht zu den Funktionen des → politischen Journalismus.
In Studien zur politischen Kommunikation ist bei dem Thema insbesondere ein enger Bezug zwischen der Kontrollfunktion der Medien und der → Vertrauensforschung (vgl. Hans 2015: 353-402) hergestellt worden: „Journalismus braucht Vertrauen, weil er das Misstrauen zu seiner Maxime erklärt hat. Art. 5 des Grundgesetzes sichert die Pressefreiheit aus diesem Grund: die Kontrollfunktion der Medien besteht darin, Misstrauen zu institutionalisieren, alles zu hinterfragen, nichts zu glauben.“ Dies ist die Grundeinstellung, auf der insbesondere ‚investigativer Journalismus‘ operiert: „Vertraut uns, denn wir misstrauen für euch.“ Mit dieser Einstellung sollen Missstände, Skandale und Fehlverhalten von Akteuren aufgedeckt werden (Hans 2023/24: 9).
In allgemeiner Form wird in der Journalismusforschung untersucht, ob sich in den → Medieninhalten eine Berichterstattung nach dem Muster der Vierten Gewalt nachweisen lässt und welche Kommunikationsabsichten der Journalist:innen dahinter vermutet werden können. Im Zentrum steht hier aber traditionell, diese Kommunikationsabsichten hinsichtlich der Faktoren Kritik und Kontrolle in repräsentativen Studien direkt abzufragen und dazu auch ihre Handlungsrelevanz zu erfassen. Dabei wurde zwischen 1993 und 2005 ein signifikanter Wandel festgestellt. Die Wahrnehmung einer gesellschaftlich aktiven Rolle im Journalismus war zunehmend in den Hintergrund gerückt, zumal Kritik an Missständen und die Kontrolle von Macht geringere Auswirkungen als früher zu haben schien. Ob sich daran in jüngster Zeit etwas geändert hat, erscheint im Lichte neuester Daten noch unklar (Weischenberg/Scholl 1978: 175-180; Weischenberg et al.: 106-110; v. Garmissen et al. 2025).
Ein eigenes Forschungsfeld bedient im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit der Berichterstattung der in Form von → ‚Public Relations‘ auf den Journalismus einwirkende Lobbyismus aus den Bereichen Politik und → Wirtschaft, dessen Ziel es ist, Kritik und Kontrolle durch die Medien zu unterlaufen. Wie stark dieser Einfluss inzwischen ist, konnte in einschlägigen Studien immer wieder nachgewiesen werden (vgl. z. B. Weischenberg 2014: 287 ff.) Als ‚Fünfte Gewalt‘ wird neuerdings die digitale Welt der → ‚sozialen Medien‘ bezeichnet, die zwar in vielfältiger Weise mit dem traditionellen → Mediensystem verknüpft ist, aber ganz neue Fragen zur technisch vermittelten Kommunikation und ihren Folgen für die Gesellschaft aufwirft.
Literatur
Ataman, Ferda: Dann nennt uns doch Lügenpresse! In: Spiegel Online, 6.10.2018. https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/meinungsfreiheit-dann-nennt-uns-doch-luegenpresse-a-1231818.html [9.7.2025]
Bergsdorf, Wolfgang: Die 4. Gewalt. Einführung in die politische Massenkommunikation. Mainz [v. Hase & Koehler] 1980.
Blum, Roger: Die bissigen Schoßhunde. Politischer Journalismus zwischen Machtkritik und Machtverliebheit. In: Pörksen, Bernhard et al. (Hrsg.): Paradoxien des Journalismus. Theorie – Empirie – Praxis. Wiesbaden [VS Verlag für Sozialwissenschaften] 2008, S. 236-246.
Burkart, Roland: Die Absichten benennen: Funktionen des politischen Journalismus. In: Prinzing, Marlies; Roger Blum (Hrsg.): Handbuch Politischer Journalismus. Köln [Herbert von Halem Verlag] 2021, S. 117-150.
Donsbach, Wolfgang: Im Bermuda-Dreieck. Paradoxien im journalistischen Selbstverständnis. In: Pörksen, Bernhard et al. (Hrsg.): Paradoxien des Journalismus. Theorie – Empirie – Praxis. Wiesbaden [VS Verlag für Sozialwissenschaften] 2008, S. 147-164.
Garmissen, Anna von et al.: Journalismus in Deutschland 2023. Befunde zur Situation und Selbsteinschätzung einer Profession unter Druck. In: Medien & Kommunikationswissenschaft, 73, 2025, 1, S. 3-34.
Gerstenmaier, Kristina: Ansichten eines Zweiflers. In: Heute Morgen Übermorgen, 9.7.2018. https://heute-morgen-uebermorgen.digital/blog/2018/07/09/ansichten-eines-zweiflers/ [9.7.2025]
Hamann, Götz: Kommt die Vierte Gewalt unter den Hammer? Die Zukunft der Süddeutschen Zeitung steht auf dem Spiel: Die Mehrheit der Eigentümer will verkaufen. In: Die Zeit, 19.4.2007, S. 29.
Hans, Barbara: Inszenierung von Politik. Zur Funktion von Privatheit, Authentizität, Personalisierung und Vertrauen. Wiesbaden [Springer VS] 2017.
Hans, Barbara: Von Dackeln und Diversität. Führungsaufgabe: Vielfalt – Warum braucht es sie? Wie gelingt sie? In: Zwoelf, 33, WS 2023/24, S. 8 f. https://www.hfmt-hamburg.de/fileadmin/u/pdf/zwoelf/zwoelf_Nr_33_web.pdf [9.7.2025]
Kunczik, Michael: Journalismus als Beruf. Köln/Wien [Böhlau] 1988.
Langenbucher, Wolfgang R.; Julia Wippersberg: Kommunikationsfreiheit. In: Weischenberg, Siegfried et al. (Hrsg.): Handbuch Journalismus und Medien. Konstanz [UVK] 2005, S. 160-165.
Löffler, Martin; Reinhard Ricker: Handbuch des Presserechts. München [C. H. Beck] 1978.
Precht, Richard David; Harald Welzer: Die Vierte Gewalt. Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist. München [Goldmann] 2022.
Prinzing, Marlies; Roger Blum (Hrsg.): Handbuch Politischer Journalismus. Köln [Herbert von Halem Verlag] 2021.
Scholl, Armin; Siegfried Weischenberg: Journalismus in der Gesellschaft. Theorie, Methodologie und Empirie. Opladen/Wiesbaden [Westdeutscher Verlag] 1998.
Schröter, Friederike; Claus Gerlach: Die Vierte Gewalt. Berlin [Kadmos] 2008.
Tonnemacher, Jan: Kommunikationspolitik. In: Weischenberg, Siegfried et al. (Hrsg.): Handbuch Journalismus und Medien. Konstanz [UVK] 2005, S. 165-171.
Weischenberg, Siegfried: Journalistik. Theorie und Praxis aktueller Medienkommunikation, Bd. 1: Mediensysteme, Medienethik, Medieninstitutionen. 3. Auflage. Wiesbaden [VS Verlag für Sozialwissenschaften] 2004.
Weischenberg, Siegfried et al.: Die Souffleure der Mediengesellschaft. Report über die deutschen Journalisten. Konstanz [UVK] 2006.
Weischenberg, Siegfried: Max Weber und die Vermessung der Medienwelt. Empirie und Ethik des Journalismus – eine Spurenlese. Wiesbaden [Springer VS] 2014.
Weischenberg, Siegfried: Medienkrise und Medienkrieg. Brauchen wir überhaupt noch Journalismus? Wiesbaden [Springer] 2018.
Weischenberg, Siegfried: Wie groß ist das ‚Elend der Medien‘? Ein Bericht zur ‚alternativen‘ Kritik des Journalismus – aus Anlass einer Sammlung von Stimmen (auch) zur Propaganda-Schlacht um die Corona-Berichterstattung. In: Journalistik. Zeitschrift für Journalismusforschung, 4, 2021/3, S. 199-217.